Heiß/Kalt-Rauschquelle
|
| Gerade in der
Radioastronomie können die Rauschparameter der verwendeten Verstärker
großen Einfluss auf die Qualität der Messungen haben. Mit
der Heiß/Kalt-Messung können Rauschzahlen von Verstärkern
auf relativ einfache Art recht genau gemessen werden. Dazu wird der
Verstärker am Eingang mit einem in der Impedanz (meist 50 Ohm)
passenden Widerstand abgeschlossen und die Rauschleistung am Ausgang
des Verstärkers gemessen. Die gemessene Leistung ist die Summe
aus dem thermischen Rauschen des Widerstandes und dem vom Verstärker
stammenden Rauschen. Wird nun der Widerstand auf eine andere Temperatur
gebracht, meist abgekühlt, ändert sich dessen thermische
Rauschleistung während die des Verstärkers gleichbleibt.
Aus dem Quotienten der beiden Leistungen, dem Y-Faktor, kann die Rauschtemperatur
und weiter die Rauschzahl des Verstärkers berechnet werden. |
Je größer der Temperaturunterschied
zwischen den beiden Messungen ist um so größer wird auch
die Genauigkeit mit der die Rauschzahl bestimmt werden kann. Im professionellen
Bereich wird zum Kühlen des Widerstandes oft flüssiger Stickstoff
mit einer Temperatur von 77°K verwendet, für die Heißmessung
bringt man den Widerstand auf Raumtemperatur mit circa 293°K.
Da Amateuren LN2 oft nicht zur Verfügung steht wird man auf Trockeneis
( 195°K ) ausweichen welches leicht beschaft werden kann. Um eine
möglichst große Differenz zu erhalten wird der Widerstand
geheizt, z.B. 100°C, entsprechend 283°K.
Da keine große Kühlleistung erforderlich ist könnte
auch ein
>>
Pulsröhren- , Striling-
oder GM-Kühler<<
verwendet werden. Aber der technische Auwand ist nicht zu unterschätzen,
ein Projekt für den ambitionierten Amateur. |
 |
|
Im hier gezeigten Messgerät werden
zwei Widerstände verwendet. Einer wird ständig gekühlt
der andere geheizt. Mit einem für Mikrowellen tauglichem Relais
werden abwechselnd die Widerstände auf den Verstärkereingang
geschaltet. So braucht bei der Messung nicht gewartet werden bis der
Widerstand die jeweilige Temperatur angenommen hat.
Das rechte Bild zeigt den Aufbau. Als Thermosgefäß dient
ein Weinkühler, der zur zusätzlichen Isolation mit Neoprenstreifen
ummantelt wurde. Links das blaue Mikrowellenrelais, dessen linker
Anschluss über eine Edelstahl Semirigid-Leitung zum 50 Ohm Widerstand
im Gefäß führt. Der rechte Anschluß führt
zum geheizten Widerstand der in einem Alublock sitzt. Dieser Block
wird mit einem aufgeschraubten Leistungswiderstand ( 5 Ohm) geheizt.
An beiden 50 Ohm Widerständen ist je ein Pt1000 Sensor zur Kontrolle
der Temperatur angebracht. Auf eine Regelung des geheizten Blocks
wurde verzichtet. Wichtig ist nur dass die Temperatur gemessen wird
und während der Rauschmessung konstant bleibt. Mit einem Heizstrom
von einem Ampere erreicht der Alublock eine Temperatur von circa 90°C
entsprechend 363°K.
Gesteuert wird mit einem Arduino, sodass zwischen Heiß und Kalt
nicht nur manuell sondern auch per RS232 Befehl umgeschaltet werden
kann. So lässt sich die Messung automatisieren. Deshalb wurde
ein ADS1115 16-Bit Analogdigitalwandler mit eingebaut um die das Signal
eines Leistungsmessers aufnehmen zu können. |
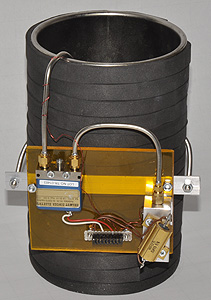 |
|
Das Rauschsignal
kann an der Frontplatte über eine N-Buchse abgenommen werden.
Mit dem Schalter über Buchse kann zwischen heiß und kalt
umgeschaltet werden, eine LED zeigt mit Rot b.z.w. Blau die Stellung
des Mikrowellenrelais an.
Auf dem LCD-Display werden die beiden Temperaturen angezeigt und über
die BNC-Buchse kann das Signal des Leistungsmesskopfes eingespeist
werden. |
 |
| >>Schaltung
im PDF-Format<< |
Diodenmessköpfe
geben ein Signal das bei einer niedrigen HF-Spannung proportional
zur HF-Leistung ist. Bei höheren Spannungen ist das Signal proportional
zur HF-Spannung. Das muss natürlich bei der Berechnung des Y-Faktors
berücksichtigt werden. Am Besten ist es wenn man den Messkopf
mit einem Messsender bei der entsprechenden Frequez kalibriert.
Statt eines Leistungsmessers kann z.B. auch ein Empfänger, z.B.
ein RTL-Stick verwendet werden. |
 |
|
 |
 |
Interessanterweise verhält sich der RTL-Stick wie
eine Diode. Bei kleine Eingansspannung ist die Übertragungskennlinie
quadratisch, bei höherer Spannung wird sie linear. Z.B. für
Rauschmessungen spielt das eine wichtige Rolle um korrekte Ergebnisse
zu erhalten.
Zwar arbeitet dieser Stick nur bis 1,7 GHz aber bei höhere Frequenzen
ist es auch sinnvoll den LNA zusammen mit dem zugehörigem Downkonverter
zu messen. |
|
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

