Elektrisiermaschine nach Holtz
|
Grundlagen:
Bei einer Auswahl alter physikalischer Geräte darf natürlich eine
Elektrisiermaschine nicht fehlen.
Eine der ersten, funktionierenden Influenzmaschine war die von Wilhelm Holtz
1865 gebaute. Angesichts des einfachen Aufbaus ist die Holtz'sche Maschine
ein schönes Bastelprojekt und die Leistung kann sich durchaus mit der
viel komplizierteren >Wimshurst
Maschine< messen. |
Auch die Holtz-Maschine besteht im wesentlichen aus zwei runden Platten
aus Isoliermaterial, wobei aber nur eine drehbar gelagert ist, die
andere Platte ist fest mit dem Aufbau verbunden. So entfällt
der bei der Wimshurst verwendete gegenläufige Antrieb.
Die einzige handwerklich schwierige Arbeit ist die Anfertigung der
feststehenden Platte die zwei, gegenüber liegende ovale Druchbrüche
haben muss. Wird aber zur Herstellung der Platten kein Glas sondern
Plexiglas, Polystyrol oder ähnliches verwendet kann man diese
Arbeit leicht mit einer Stich- oder Laubsäge machen. Die Leistungsfähigkeit
der Maschine kann stark erhöht werden indem man sie auch mit
Speicherkondensatoren (z.B. Leidner Flaschen) ausrüstet, beim
originalen Holtz'schem Entwurf sind aber keine vorhanden.
Dafür kann man nach den Erfahrungen von Rapp Instruments den
senkrechten Ausgleicherbügel mit den beiden Sprühkämmen
einsparen. Wird aber doch einer verwendet sollte er nicht fest senkrecht
stehen sondern im drehbar gelagert sein um die effektivste Position
einstellen zu können. |
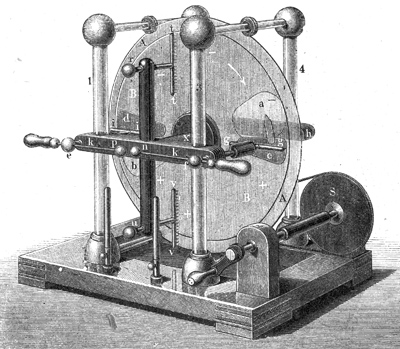 |
|
Aufbau:
Bei der hier gezeigten Maschine wurden Glasplatten (28 und 30 cm Durchmesser)
verwendet. Die Scheiben bekommt man für wenig Geld beim Glaser.
Die erforderlichen Löcher und Durchbrüche muss man mit der
Dremel mit Diamantbohrer selbst machen. Als Isolierstoff für
den Aufbau des Abnehmerträgers wurde schwarz lackiertes Plexiglas
verwendet. Dies soll den Eindruck von Hartgummi (Ebonit) erwecken,
ein Stoff der schon im 19. Jahrhundert bekannt war und für solche
Zwecke verwendet wurde. Obwohl Glas ein an sich ganz guter Isolator
ist neigt seine Oberfläche dazu sich mit einer dünnen Wasserschicht
aus der Luftfeutigkeit zu überziehen wodurch die Isolationsfähigkeit
stark herab gesetzt wird. Deshalb wurden die beiden Glasscheiben und
die meisten anderen Teile der Maschine mit Bootslack gestrichen.
Die Induktorflächen mit ihren Spitzen wurden aus dünnem,
schwarzen Karton ausgeschnitten. Die meisten schwarzen Papiere sind
etwas Leitfähig was an dieser Stelle erwünscht und auch
notwendig ist. |
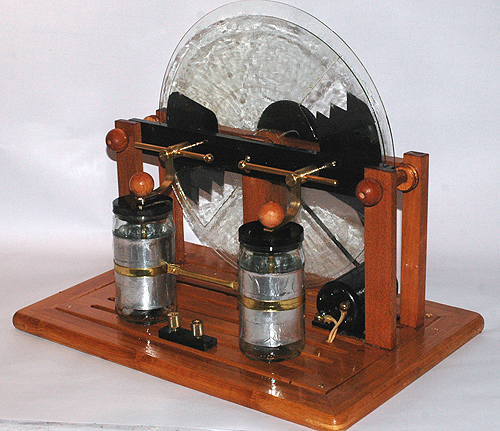 |
|
|
|
|
Die Spitzen der Abnehmerkämme sind Gramophonnadel, die in einen
Messingvierkant gepresst wurden.
Geschummelt wurde wie beim >Laser<
und der >Teslaspule< bei
den Leidner Flaschen in deren Innern sich ein keramischer Doorknop mit
jeweils 2000 pF versteckt.
Auch der Antriebsmotor ist kein Original da für solche Motoren Fanatasiepreise
von weit über Hundert Euro zu bezahlen sind. Deshalb befindet in
dem auf Alt getrimmten Gehäuse ein moderner Mabuchi-Motor.
|
 |
Betrieb:
Bei der ersten Inbetriebnahme und nach längeren Ruhepausen muss
die Maschine erst gestartet werden. Dazu bringt man elektrische Ladung
auf eine der beiden Induktorflächen. Das kann mit einem geriebenem
Kunststoffstab, einem HV-Netzgerät oder einer sonstigen Hochspannungsquelle
geschehen. Eine smarte Methode ist der Start mit einem piezoelektrischen
Gasanzünder.
Eine Eigenart der Holtzschen Maschine ist, dass sie am Besten mit
kurz geschlossener Funkenstrecke startet. Die einsetzende Erregung
der Maschine hört man am Laufgeräusch, da der Motor nun
stärker belastet wird. |
| An den Abnehmerspitzen sieht man nun im abgedunktlem
Raum Sprüherscheinungen die wegen unterschiedlichen Polarität
der Spitzen unterschiedlich ausfallen. 8 mm 30kV |
|
| |
|
| |
| |

